
 | Independent Carinthian Art & Cult | |
| Thu May 01 2025 14:55:19 CET |
|
2011-05-27 Thomas Gröbly: „Gemeinsam geht’s besser!“ Am Beispiel mit einer Bauernfamilie, einer Großmolkerei, einer einkaufenden Familie, einer Bank und eines Großverteilers zeigt sich, wie Ernährungssouveränität funktioniert und funktionieren könnte. . Redaktionelle Anmerkung Nebenstehender Beitrag ist zuerst erschienen in der äußerst empfehlenswerten Zeitschrift: 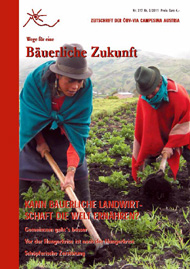 Heuer stand der Weltladentag unter dem Motto Die Bauernfamilie Berger hat 20 Kühe und liefert ihre Milch der Großmolkerei Thaler ab. Bergers möchten qualitativ gute Milch liefern, soviel dafür bekommen, dass sie gut leben können und den Hof ohne hohe Schulden an ihre Tochter oder ihren Sohn abgeben können. Herr Thaler, der eben drei Kleinmolkereien aufgekauft und in eine moderne Anlage zur Milchverarbeitung investiert hat, möchte einen tiefen Milchpreis und seine Produkte auch im nahen Ausland verkaufen. Er erwägt, günstigere Milch von da zu kaufen. Da er quasi das Monopol hat, können Bergers zurzeit nirgends sonst ihre Milch liefern. Die Bank Thalheim hat Thaler für seinen Wachstumskurs Geld geliehen. Auch wenn der Zins tief ist, scheint das für die Bank ein sicheres Geschäft zu sein. Herr und Frau Heimthaler wollen gute und günstige Milch für ihre Familie mit den fünf Kindern. Sie zahlen jährlich in den Pensionsfonds der Bank Thalheim ein und sind im Alter auf die Rente angewiesen. Sie möchten also einen möglichst hohen Zins auf ihr hart Erspartes. Sie kaufen die Milch beim Großverteiler Bergheim, welcher die regionale Milch mit einem Label versieht. Bergheim ist bekannt für sein ökologisches Engagement, insbesondere seine „Grünmilch“. Die richtigen Fragen stellen So ist, etwas vereinfacht gesagt, unsere Ernährung organisiert. Die verschiedenen Akteure haben je eigene Interessen, welche mit anderen im Konflikt stehen. Wer die größte Macht hat, wird seine Interessen durchsetzen. Könnte die Bäuerliche Landwirtschaft in einer solchen Wirtschaftsordnung die Welt ernähren? Diese Frage darf aber nicht abgelöst von anderen Fragen gestellt werden. Welche Lebensmittelproduktion und Lebensmittelvermarktung kann:
Meine These lautet: Das geht nur mit Biolandbau und Ernährungssouveränität. Peak everything als Herausforderung Zu den Fragen der Wirtschaftsordnung kommen heute noch weitere Herausforderungen auf uns zu: Peak Oil, Hunger und Armut, Energiekrise, Klimakrise, Wasserkrise, Bodenkrise, Finanzkrise also ein „Peak Everything“. Sind wir bis heute davon ausgegangen, dass für alles genug Energie da ist, müssen wir uns neu orientieren und diskutieren, was wir mit der beschränkten Menge machen wollen. Beschränkt ist die Menge, weil das Erdöl zu Ende geht und die Atomenergie keine Alternative ist. Wir müssen vom stetigen Wachstum und dem „größer-schneller-mehr“ Abschied nehmen. Das ist auch eine Krise der Seele, weil wir meinen, Lebensqualität und Glück sei identisch mit Energie- und Naturverbrauch, mit Wachstum und Beschleunigung. An der Landwirtschaft verdienen! Diese Krisen sind unter anderem durch ein Marktdenken, durch eine Ökonomisierung hervorgerufen, welche für unsere Zeit maßgeblich ist. Dazu drei Thesen:
Das Fazit dieser Analyse lautet, dass angesichts der vielfältigen Krisen der grosse Streit um die letzten Ressourcen stattfindet. Und da wird weder auf die Natur noch auf Menschen Rücksicht genommen. Sind die Folgen in vielen Ländern des Südens offensichtlich, sind sie bei uns oft nur schwer erkennbar. Die Ausbeutung der Landarbeiter in Almeria oder Sizilien, Existenznot der BäuerInnen und Working poors auf der ganzen Welt, usw. Alle Bauern weltweit leiden also unter ähnlichen Problemen: Ausbeutungen, Abhängigkeiten, Verschuldung, Finanznot und letztlich psychischen Not wegen einer grassierenden Zukunftsunsicherheit. Ernährungssouveränität als Antwort Es gibt verschiedene Definitionen von Ernährungssouveränität. Der Begriff droht zu einem Modewort zu werden. Das finde ich deshalb ein Problem, weil Gefahr besteht, dass der Begriff an kritischem Potenzial verliert. (Genauso geschah es mit der Nachhaltigkeit). Ich beziehe mich hier auf das Konzept von Via Campesina, weil es mir als sinnvoll erscheint und weil dahinter der größte Bauernverband mit mehr als 60 Millionen Bauern und Bäuerinnen steht. „Ernährungssouveränität bezeichnet das Recht der Bevölkerung, eines Landes oder einer Union, die Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik ohne Preis-Dumping gegenüber anderen Ländern selbst zu bestimmen. Das Konzept geht vom Vorrang der regionalen und nationalen Selbstversorgung aus. Produzent/innen, Verarbeiter/innen und Verbraucher/innen verpflichten sich zu transparenter Deklaration und kostendeckenden Preisen, damit die Bäuer/innen nachhaltig produzieren können.“ Die Ziele des Konzepts der Ernährungssouveränität bestehen darin, die bäuerliche Landwirtschaft zu stärken, die lokale Ernährungssicherheit zu erhöhen, eine möglichst große Unabhängigkeit von anonymen Märkten und multinationalen Konzernen zu erreichen sowie die Agrar- und Verbraucherpolitik demokratisch zu legitimieren. Es verbietet Preisdumping und garantiert den Bäuerinnen und Landarbeitern einen gerechten Lohn. Bäuer/innen sollen sich nur auf Märkte abstützen, welche sie zumindest teilweise kontrollieren können. Ernährungssouveränität ist ein Mittel dazu. Das ist keine rückwärtsgewandte Nostalgie, sondern ein notwendiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Planeten und der Landwirtschaft weltweit. Deshalb brauchen wir mehr Bäuer/innen! Alle gewinnen Was wäre nun anders, wenn wir dieses Konzept auf unser Beispiel übertragen? Die Bauernfamilie Berger hat sich mit anderen Bauernfamilien und Heimthalers und weiteren Konsument/innen zu einer Milch-Genossenschaft zusammengeschlossen. Diese Genossenschaft zahlt Bergers einen kostendeckenden Preis für ihre Milch. Es wird nur lokale Milch verarbeitet, welche dann auch wieder lokal verkauft wird. Heimthalers können nun eine gute Milch zu einem fairen Preis kaufen. Sie haben zudem ihr Pensionskassegeld in die Genossenschaft investiert. Es gibt da nur einen kleinen Zins, aber sie wissen, dass mit ihrem Geld etwas Gutes gemacht wird und dass es sicher angelegt ist. Welche Bank kann uns das heute noch garantieren? Die Molkerei Thaler ließ sich überzeugen, dass sie eine kleine Molkerei der Genossenschaft überlassen soll. Die Bank Thalheim hat mitgeholfen eine zinslose Regionalwährung aufzubauen. Somit besteht kein Druck mehr zum Wachstum, es werden faire Preise bezahlt und es werden neue lokale Arbeitsplätze geschaffen. Nur der Großverteiler Bergheim ist Verlierer, weil seine Milch zu teuer ist und er keine Bauernfamilien mehr findet, die ihm Milch liefern. Ich habe hier etwas plakativ beschrieben, wie das Konzept der Ernährungssouveränität im Alltag aussehen könnte. Es fehlen natürlich noch viele Details und wir leben ja auch nicht von Milch alleine. Indem die Lebensmittel aus dem Geldwirtschaftskreislauf herausgenommen werden verschwindet der tödliche Wachstumszwang. Dadurch können die Bauern wieder Sorge tragen für ihren Boden, ihr Saatgut, das Wasser und Energie sparen. Eine Ökointensivierung produziert in vielfältigen Systemen mit geringem Input große Erträge und so, dass wir auch in Zukunft gesunde Lebensmittel anbauen können. Wichtig ist auch, dass alle Beteiligten an Selbstbestimmung gewinnen, denn die Steuerung von Angebot und Nachfrage wird nicht mehr dem anonymen Markt überlassen, sondern wird vertraglich geregelt. Damit wird das Wetter- und Ernterisiko auf alle verteilt und es ist nicht mehr nötig, Überschüsse zu produzieren, damit genug geliefert werden kann. Es ist ein Ausweg aus der „Landwirtschaftlichen Tretmühle“, welche darin besteht, dass jede Effizienzsteigerung zu einem tieferen Preis führt. Es ist also ein finanzielles Nullsummenspiel, bei dem Natur und Menschen unter die Räder kommen. Mehr Achtsamkeit mit Ernährungssouveränität Ernährungssouveränität bedeutet eine solidarische Einbindung in die lokale und globale Welt mit einem Höchstmaß an Mitbestimmung und ein Ende der Ausbeutung von Menschen und Natur im Dienste des Kapitals. Es ist eine realistische und heute realisierbare Alternative und eine Antwort auf die verschiedenen Krisen. Ernährungssouveränität wird uns nicht geschenkt, sondern diese müssen wir uns nehmen, da wo wir leben. Für die Bäuer/innen liegt es auf der Hand sich für Ernährungssouveränität zu engagieren. Dies aus Eigennutz, aber auch aus der Überzeugung, dass wir eine Welt sind und als Menschen alle zusammen gehören. Der lokale Zusammenhalt und die hohe Verbindlichkeit ermöglichen Respekt und Achtsamkeit und nicht zuletzt eine gesicherte Existenz und Zufriedenheit. Thomas Gröbly
Keine Reaktionen vorhanden |
|