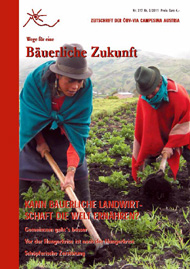2011-05-22
Irmi Salzer: Yes, we can!
Mit diesem schon etwas abgedroschenen Slogan ist eine Frage hinreichend beantwortet: Können wir (Klein-)Bäuerinnen und Bauern die Welt ernähren?
.
Redaktionelle Anmerkung
Nebenstehender Beitrag ist zuerst erschienen in der äußerst empfehlenswerten Zeitschrift:
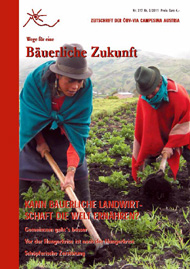
Heuer stand der Weltladentag unter dem Motto  „öko&fair ernährt mehr!“. Weil die erhobenen Forderungen aus unserer Sicht – bei aller auszudiskutierender Widersprüchlichkeit – in die richtige Richtung gehen, hat sich der ÖIE in Villach an der Aktion beteiligt.
„öko&fair ernährt mehr!“. Weil die erhobenen Forderungen aus unserer Sicht – bei aller auszudiskutierender Widersprüchlichkeit – in die richtige Richtung gehen, hat sich der ÖIE in Villach an der Aktion beteiligt.
Für uns ist das der Grund, in den nächsten Wochen einige Beiträge zum Thema Landwirtschaft und Perspektiven unserer Ernährung zur Diskussion zu stellen. Ganz herzlichen Dank an die ÖBV-Via Campesina Austria für die Kooperation.
Ja, aber sicher – vorausgesetzt, die Welt ernährt sich anders. Wenn wir den rasant wachsenden Fleischkonsum reduzieren und unsere Wegwerfgesellschaft in den Griff bekommen, brauchen uns Bevölkerungswachstumsprognosen und kolportierte Horrorszenarien nicht zu beunruhigen. Denn dass sie vorwiegend dazu dienen, der Agroindustrie samt Gentechnik und Großgrundbesitz Tür und Tore zu öffnen, dürfte nach der „Grünen Revolution“ kaum mehr überraschen.
Wie aber kommen wir dazu, die Einwände von Wissenschaft und Entscheidungsträger/innen einfach so vom Tisch zu wischen? Zunächst einmal könnten wir fragen: Wer ernährt die Welt denn jetzt? In großen Teilen der Welt ist es nämlich nach wie vor die kleinbäuerliche Landwirtschaft. 2,6 Milliarden Menschen leben hauptsächlich von der Landwirtschaft. 85% der etwa 525 Millionen Bauernhöfe weltweit bewirtschaften weniger als zwei Hektar Land (der Löwenanteil dieser Höfe liegt übrigens in Asien). Die Bauern und Bäuerinnen auf diesen Klein- und Kleinstbetrieben bauen den größten Teil aller weltweit produzierten Lebensmittel an. Dabei soll gar nicht bestritten werden, dass die Produktivität der Landwirtschaft in vielen Regionen gesteigert werden müsste. Doch dazu brauchen Kleinbäuer/innen Zugang zu Märkten, Transportmöglichkeiten, Wasser, Krediten und Saatgut und vor allem auch Aus- und Weiterbildungsangebote.
Zudem zeigen Studien, dass vielfältig wirtschaftende kleine Betriebe weitaus produktiver sind als große Monokulturen, ja dass sie sogar zwei- bis zehnmal mehr pro Flächeneinheit produzieren. Zieht mensch nämlich Kriterien heran, die alle eingesetzten Produktionsfaktoren berücksichtigen (d.h. neben Arbeitskraft und Kapital auch Energie, Dünger und Wasser) und die zudem den Gesamtertrag des Betriebs analysieren, dann schneiden kleine Betriebe in der Mehrzahl der Fälle besser ab als große. In anderen Worten: Industrialisierte Farmen mögen pro Flächeneinheit zwar höhere Erträge an Weizen, Mais oder Soja abwerfen, ihr gesamter Ertrag pro Fläche ist jedoch geringer. Dies rührt daher, dass Kleinbäuer/innen dazu tendieren, „das meiste aus ihrem Land zu machen“, dass sie also Zwischen- und Mischkulturen anbauen, ihre Fruchtfolgen optimieren und jeden Winkel ausnützen.
Dass die bäuerliche Landwirtschaft die Welt ernähren kann, steht also außer Frage – unter der Voraussetzung, dass sie selbst überlebt. Für ihr Überleben aber braucht es eine Umorientierung der weltweiten Agrar-, Handels- und Entwicklungspolitik – weg von der „heiligen Kuh Weltmarkt“, und hin zur Ernährungssouveränität.
.