2012-01-16
ERINNERN an einen vergessenen Hermagorer: Johann Koplenig
Sein Name ist heute vielen Österreicher/innen kein Begriff, und selbst in seinem Geburtsort Hermagor erinnert man sich kaum an den einst großen Politiker, der Österreich nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges politisch wieder aufbaute.
.
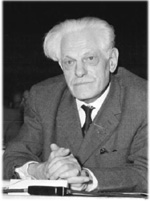 Johann Koplenig, 1963
Johann Koplenig, 1963
Der anerkannte britische Historiker Eric Hobsbawm will herausgefunden haben, wieso politischer Radikalismus unter Schustern besonders hoch ist – wieso also der Schuster nicht bei seinen Leisten bleiben will – und geht von der Annahme aus, dass die relativ leichte Arbeit in Sitzposition dem Schuhmacher die Möglichkeit biete, viel nachzudenken, zu reden, gedankliche Ausschweifungen in das Reich der Utopie zu unternehmen und sich dadurch auch früher oder später politischer Kritik und revolutionärem Gedankengut widmen kann.
Auf den 1891 in Jadersdorf bei Hermagor geborenen und aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Johann Koplenig dürfte diese Annahme zutreffen. Nach lediglich zwei Jahren Volksschule im Bezirk Hermagor musste der junge Koplenig aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten seiner Eltern in die Lehre gehen und wurde: Schuster.
Bereits in jungen Jahren begann er, sich für Politik zu interessieren und trat zunächst der Sozialdemokratischen Partei bei. Mittlerweile im steirischen Judenburg wohnhaft, wurde er auch aktiv und organisierte 1911 einen Streik der Schuhmacher – was zu seiner Entlassung führte und ihn nach Knittelfeld verschlug, wo er glücklicherweise nicht nur seiner Arbeit als Schuhmacher weiter nachgehen konnte, sondern sich auch mit der Gründung der Ortsgruppe des "Verbandes jugendlicher Arbeiter Österreichs" auch weiter politisch artikulieren und einen Namen machen konnte konnte.
Nach seiner kurzen politischen Laufbahn in Österreich war er 1914 gezwungen, am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Glück im Unglück hatte Koplenig allerdings, als er bereits im November desselben Jahres in russische Kriegsgefangenschaft geriet, wo er die Ideen des Kommunismus kennenlernte – die er bis zu seinem Tod 1968 vertrat und politisch lebte. Nach der russischen Revolution 1917 entdeckte er den in Europa verhassten Bolschewismus für sich, bis er nach seiner Heimkehr 1920 die österreichische KP mit aufbaute, wo schließlich seine eigentliche politische Karriere u.a. als Landesparteisekräter in der Steiermark oder als leitender Sekräter der Partei begann.
Einen höheren Bekanntheitsgrad erreichte er 1927, als er nach dem Justizpalastbrand in Wien ursprünglich verhaftet werden sollte, aber wieder freigelassen wurde, nachdem er der Regierung und der Polizei drohte, sie des Mordes (im Zuge der Auseinandersetzungen vor dem Justizpalastbrand am 17. Juli 1927) anzuklagen. Koplenig profilierte sich daraufhin als kompetenter und angesehener Politiker, beobachtete die politischen Veränderungen in Österreich jedoch mit großer Sorge: der Aufstieg des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus drängten Kommunist/innen und Sozialdemokrat/innen in die Illegalität, wo der inner-österreichische Widerstand zur Massenbewegung wurde. Offenes Ziel dieser illegalen Bewegung, der Johann Koplenig als führende Kraft angehörte, war ein freies und unabhängiges Österreich.
Den Anschluss Österreichs an Deutschland 1938 kommentierte Koplenig enttäuscht, doch nicht minder hoffnungsvoll: „Für das österreichische Volk ist der Kampf um seine Unabhängigkeit nicht zu Ende. Es wird niemals eine ihm aufgezwungene Fremdherrschaft anerkennen. So schwer sich auch in der nächsten Zeit sein Schicksal gestalten mag, der Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs wird aufs Neue entbrennen.“
1938 floh Koplenig vor den Nazis zunächst nach Prag, später nach Paris und schließlich nach Moskau, von wo aus er sich ebenfalls für ein freies, unabhängiges Österreich einsetzte, u.a. als Referent bei Antifaschismuskursen in österreichischen und deutschen Kriegsgefangenenlagern.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Karl Renner von Stalin mit der Regierungsbildung beauftragt. Hierzu lud Renner neben Leopold Figl und Adolf Schärf auch den wieder nach Österreich zurückgekehrten Johann Koplenig in das Amt als Staatskanzler ein. Am 27. April 1945 wurde schließlich die Österreichische Unabhängigkeitserklärung präsentiert, bei deren Erarbeitung Koplenig maßgeblich beteiligt war. Bis 1956 war Johann Koplenig im österreichischen Nationalrat tätig, wo er sich u.a. engagiert gegen den „Klassenparagraphen 144“ (Abtreibungsverbot) und ein frauenfeindlichen Ehe- und Familienrecht einsetzte.
Die weiteren, ungünstigen Entwicklungen in der realsozialistischen Sowjetunion sowie innerparteiliche Auseinandersetzungen in der KP bewegten Johann Koplenig drei Jahre vor seinem Tod dazu, aus der Partei auszutreten. Am 13. Dezember 1968 verstarb Koplenig.
Es war nicht zuletzt der kommunistische Widerstand, der Österreich nach dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges den Opferstatus gewährte. Allerdings zu Unrecht, wie Johann Koplenig fand, der bereits nach dem Ausgang des Krieges und seiner Rückkehr nach Österreich von der Mitschuld Österreichs am Krieg sprach – was ihm in der österreichischen Bevölkerung keine Sympathiepunkte einbrachte. Erst ab den 1990er Jahren – Jahrzehnte nach Koplenigs Tod – wurde die tatsächliche Mitschuld Österreichs am Hitler-Krieg erstmals öffentlich thematisiert. Heute sind sich Historiker darüber einig, dass Österreich kein Opfer Nazi-Deutschlands war, sondern Mittäter an den Verbrechen des europäischen Faschismus.
Johann Koplenig war beides: er übte einerseits Widerstand gegen den NS aus, verbat sich jedoch gleichzeitig den falschen Anspruch der Österreicher/innen der Nachkriegszeit als Opfervolk, als angeblichen Hort des Widerstandes gegen die deutschen Faschisten und als Unschuldslamm. Der „Herr Karl“ (wie ihn Helmut Qualtinger in einem seiner Filme spielte) war etwas, mit dem Johann Koplenig nicht einverstanden war. Konnte er doch - im Gegensatz zum „Herrn Karl“ – zurecht und ehrlich den Verdienst in Anspruch nehmen, als Österreicher eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Nationalsozialismus und später eine unverzichtbare Rolle im politischen Aufbau Österreichs eingenommen zu haben.

